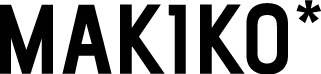Viele kleine NGOs setzen auf Kommunikation, Kampagnen und Community-Arbeit – doch wenn es um politische Interessenvertretung geht, bleiben Potenziale ungenutzt. Dabei zeigt sich: Ohne strategische Public Affairs ist langfristige Wirkung kaum möglich. Warum das so ist, welche Chancen verloren gehen und wie selbst kleine Organisationen erste Schritte machen können, erklärt Julius, Geschäftsführer von MAKIKO und der NGO Viva Equality.
Kleine Organisationen, großes Potenzial – aber keine Public-Affairs-Strategie?
In Deutschland gibt es abertausende kleine und mittelgroße NGOs, die gesellschaftlichen Wandel anstoßen – sei es im Bildungsbereich, in der Sozialen Arbeit, in der Demokratiebildung oder in der Umweltpolitik. Sie arbeiten oft nah an den Lebensrealitäten von Betroffenen, kennen Strukturen, Lücken und Herausforderungen – und haben somit wertvolle Impulse für politische Entscheidungsprozesse.
Doch genau diese Organisationen sind in politischen Diskursen meist nicht oder kaum präsent.
Die Gründe dafür sind vielfältig – und lassen sich auf drei zentrale Hürden herunterbrechen:
1. Ressourcenmangel: Wenn das Tagesgeschäft alles frisst
Viele NGOs arbeiten unter hohem finanziellen Druck. Zeit- und Personalmangel gehören zum Alltag. Die wenigen Mitarbeitenden jonglieren operative Aufgaben, Förderanträge, Projektumsetzung und Kommunikation. Public Affairs wirkt da wie ein zusätzlicher, kaum zu stemmender Luxus.
Aber: Gerade in diesem Umfeld kann strategische politische Arbeit Entlastung schaffen, etwa durch neue Förderstrukturen, strukturelle Partnerschaften oder politische Unterstützung.
2. Wissenslücke: Was Public Affairs eigentlich ist – und warum es wirkt
Das zweite Problem ist oft ein konzeptionelles: Public Affairs ist vielen kein klarer Begriff.
Dabei umfasst dieser Bereich genau die Maßnahmen, mit denen Organisationen politische Rahmenbedingungen mitgestalten können:
- Positionspapiere und Policy Briefs
- Hintergrundgespräche mit Entscheidungsträger*innen
- Stakeholder-Mapping und Netzwerkpflege
- Teilnahme an Anhörungen oder Fachgremien
Was in der Wirtschaft längst strategisch betrieben wird, wirkt im Non-Profit-Sektor oft elitär oder unnahbar. Dabei sind es gerade die kleinen Organisationen, deren Perspektiven und Expertise in politischen Prozessen fehlen – obwohl sie dringend gebraucht werden.
3. Fehlende Strukturen: Ohne Plan kein Durchbruch
Selbst wenn das Interesse da ist, fehlt vielen Organisationen der Rahmen. Es gibt keine Zuständigkeiten, keine Leitlinie, kein Zielbild für politische Arbeit. Aktionen bleiben punktuell, Kontakte versanden.
Was stattdessen nötig wäre: ein strategischer Ansatz mit klarer Zieldefinition, Rollenverteilung und regelmäßigem Dialog mit politischen Akteur*innen. Genau das ist der Kern von wirksamen Public Affairs.
Der Preis des Schweigens: Was NGOs verlieren, wenn sie Public Affairs ignorieren
Wenn NGOs in politischen Prozessen nicht vorkommen, werden ihre Themen nicht gehört – und bleiben auf der Ebene von Projekten oder Einzelmaßnahmen stecken. Die Folge:
- Förderbedingungen bleiben unpassend
- Innovative Ansätze erreichen keine strukturelle Wirksamkeit
- Gesetzesinitiativen laufen an der Realität vorbei
- Budgets werden ohne ihre Perspektive verteilt
Kurz gesagt: Wer sich nicht sichtbar macht, verliert Gestaltungsmacht. Und gerade im sozialen Bereich bedeutet das oft: weniger Gerechtigkeit, weniger Zukunft, weniger Wirkung.
Aber wie anfangen? Fünf erste Schritte für kleine NGOs
Auch ohne eigenes Public-Affairs-Team können NGOs beginnen, sich politisch zu positionieren. Hier fünf pragmatische Einstiegsmöglichkeiten:
1. Zielbild definieren
Welche politischen Ziele hat eure Organisation? Geht es um Gesetzesänderungen, bessere Rahmenbedingungen, neue Förderstrukturen? Klärt, was ihr wirklich bewegen wollt.
2. Stakeholder analysieren
Wer sind die wichtigsten politischen Entscheidungsträger*innen auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene? Welche Ausschüsse, Ministerien oder Fraktionen beschäftigen sich mit euren Themen?
3. Botschaften schärfen
Was ist eure zentrale politische Botschaft? Warum ist sie aktuell, relevant und notwendig? Entwickelt ein klares Wording, das euer Anliegen auf den Punkt bringt.
4. Kontakte aufbauen
Nehmt aktiv Kontakt zu politischen Vertreter*innen auf. Das kann über Hintergrundgespräche, Fachveranstaltungen oder persönliche Anschreiben geschehen. Wichtig: Dranbleiben. Kontinuität schlägt Aktionismus.
5. Interne Zuständigkeiten klären
Wer in der Organisation kümmert sich um politische Kommunikation? Auch wenn es nur eine halbe Stelle oder ein Ehrenamt ist – ohne klare Verantwortung bleibt Public Affairs ein leeres Versprechen.
Expertise aus der Praxis: Warum Julius auf Public Affairs setzt
Julius, Geschäftsführer von Makiko und der NGO Viva Equality, hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit Public Affairs beschäftigt. Was als Ergänzung zu Kommunikation und Strategie begann, hat sich inzwischen zu einem zentralen Wirkungsfeld entwickelt.
„Wir sehen bei Viva Equality wie groß der Hebel politischer Kommunikation ist. Ohne diese Arbeit bleibt Wirkung oft auf der Strecke.“
Fazit: Public Affairs ist kein „Add-on“, sondern Teil wirksamer Strategien
In einer Zeit, in der politische Entscheidungen immer schneller getroffen werden und gesellschaftliche Konflikte zunehmen, dürfen NGOs nicht an der Seitenlinie stehen. Sie müssen ihre Stimmen einbringen – fundiert, strategisch und kontinuierlich.
Public Affairs ist dabei kein Thema nur für große Organisationen. Gerade kleine NGOs haben oft die stärksten Argumente, die besten Geschichten und die dringendsten Anliegen. Sie brauchen nur den Mut – und die Struktur – sie auch politisch zu vertreten.
Interesse an einem Public-Affairs-Workshop für eure Organisation?
MAKIKO begleitet euch dabei, eure politischen Potenziale zu erkennen, Strategien zu entwickeln und erste Schritte zu gehen – praxisnah, niedrigschwellig und wirksam.